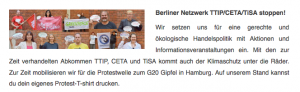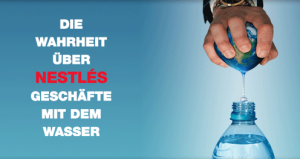Privatsphäre stärkt, Überwachung schwächt! #StopScanningMe


Suche

Schiefergas-Fracking in Deutschland?

#StopEUMercosur Erklärung

Aktion Greenpeace: #StopEUMercosur
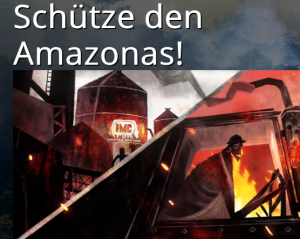
#SaveTheOkavangoDelta

Erfolgreich! Über 1 Million Unterschriften „Green Deal“ – Europäische Bürgerinitiative (EBI)

Stop Energiecharta. #NoECT. Wir wollen raus aus dem Anti-Klimaschutz-Vertrag

Europäische Bürgerinitiative gegen biometrische Massenüberwachung (17.2.2021-17.2.2022)

Lebensgefährliche Entwicklung: Gewinnorientierung im Krankenhaus
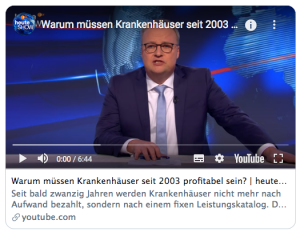
- Wassertisch-Plenum,
im NewYorck / Bethanien Mariannenplatz 2A
10997 Berlin Openstreetmap fällt coronabedingt aus Überblick (Messstellen: Oberflächengewässer und Grundwasser)
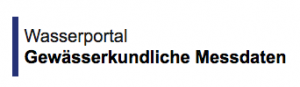

-
Letzte Beiträge
- AöW zum Weltwassertag 2023: Interkommunale Zusammenarbeit noch stärker ermöglichen
- Greenpeace: Fracking – eine unterirdisch schlechte Idee
- Bürgerinitiative gegen CO2-Endlager: Offener Brief an den Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz Dr. Robert Habeck
- BUND gegen CCS-Endlager
- Jürgen Knirsch: CETA-Handelsabkommen: Eine trügerische Wette auf die Zukunft (Leserbrief an die SZ vom 8.12.2022)
- Neuere Materialien und Dokumente zur CETA-Debatte
- TAZ: Hamburger Abgeordneter über Olympia-Gedankenspiele: „Es kommt zu Vertreibungen“
- NDR: Bewirbt sich Hamburg noch einmal um Olympische Spiele?
- NGO-Bündnis fordert mit gemeinsamen Appell die Senkung des absoluten Ressourcenverbrauchs
- Allianz der öffentlichen Wasserwirtschaft warnt vor CETA: Mit dem jetzigen CETA-Text wird der Schutz der öffentlichen Wasserwirtschaft vor einer Kommerzialisierung weiter geschwächt

Delius-Klage
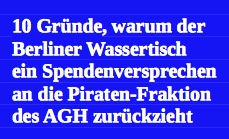
Keine Steuergelder für LNG-Fracking-Gas Terminals in Deutschland!

RSS-Feeds
Schlagwort-Archive: Gewässerschutz
BUND: Gewässerschutz: EU-Vorgaben verschleppt – Guter Zustand der Gewässer in weiter Ferne

Pressemitteilung vom 21. Juni 2021
Berlin. Deutschland verstößt gegen europäische Vorgaben zum Gewässerschutz. Nach den Plänen der Bundesländer werden bis 2027 anders als vorgeschrieben nur wenige Gewässer in einen guten ökologischen Zustand versetzt, kritisiert der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) in seiner Stellungnahme (pdf) zur europäischen Wasserrahmenrichtlinie (WRRL). Für viele Seen und Flüsse – wie beispielsweise die Elbe – werden die Ziele bis ins Jahr 2045 oder gar darüber hinaus verschoben. Dies verstößt gegen geltendes EU-Recht. Der BUND verlangt von den Bundesländern daher wesentliche Nachbesserungen der behördlichen Planungen.
Olaf Bandt, BUND-Vorsitzender: „Deutschland gefährdet den Schutz unserer Lebensgrundlage Wasser, wenn die Umsetzung des Gewässerschutzes erst in ferner Zukunft erfolgen soll. Wir müssen jetzt handeln, denn wir befinden uns bereits mitten in einer Gewässerkrise. Um die Ziele für 2027 zu erreichen, müssen Bund und Länder sehr deutlich nachbessern. Es geht nicht nur darum, dass wir in Zukunft genug Wasser zur Verfügung haben, auch die Qualität muss stimmen.“
Die Herausforderungen wachsen mit der Klimakrise. In Dürrezeiten führen Flüsse weniger Wasser, damit steigt deren Schadstoffkonzentration. Bei Starkregen belasten unkontrollierte Einleitungen von verschmutztem Mischwasser und Straßenabwasser die Gewässer. Die Politik muss einerseits die notwendigen finanziellen und personellen Ressourcen zur Verfügung stellen. Andererseits müssen schädliche Bewirtschaftungsmethoden unterbunden werden.
Die Länder identifizieren beispielsweise die Landwirtschaft unter anderem wegen zu hoher Nitrateinträge als eine Hauptverursacherin schlechter Wasserqualität. Auch mit den durch Erosion ausgelösten Sedimenteinträgen trägt sie maßgeblich zum schlechten Zustand bei. Steuerfinanzierte Agrarbeihilfen darf es künftig nur noch geben, wenn Gewässerschutzstandards eingehalten werden.
Bandt: „Bereits 2017 hat der BUND EU-Beschwerde eingelegt. Wir erwarten von der Bundesregierung einen strategischen Aktionsplan, in dem konkrete Maßnahmen systematisch aufeinander aufgebaut sind. Doch dieser Plan fehlt. Dreh- und Angelpunkt ist auch eine aktive Beteiligung der Öffentlichkeit. Nur so gibt es gesellschaftlichen Rückhalt für die notwendigen Maßnahmen, um das Allgemeingut Wasser zu schützen. Fristverlängerungen nach 2027 dürfen nur gut begründete Ausnahmen sein. Je länger wir warten, desto teurer wird künftiger Gewässerschutz. Wir haben es in der Hand, künftigen Generationen einen Zugang zu kostbarem Trinkwasser zu ermöglichen.“
Der BUND wird zum Fristende der Öffentlichkeitsbeteiligung (zwischen 21. und 30. Juni) für alle großen Flussgebiete ausführliche Stellungnahmen abgeben. Der Umweltverband macht zudem Vorschläge zu Maßnahmen, um den guten ökologischen Zustand an Flüssen, Seen und für das Grundwasser bis zum Jahr 2027 zu erreichen.
Weitere Informationen:
Die Stellungnahme des BUND finden Sie unter: www.bund.net/stellungnahme-wrrl (pdf) Zur Wasserrahmenrichtlinie, der europäischen Richtlinie zum Gewässerschutz: https://www.bund.net/fluesse-gewaesser/wasserrahmenrichtlinie/
Zur EU-Beschwerde zur Wasserrahmenrichtlinie von BUND und NABU, in der schon viele der Defizite beschrieben wurden: https://www.bund.net/fileadmin/user_upload_bund/publikationen/fluesse/fluesse_wrrl_eu-beschwerde.pdf
BUND-Gewässerreport 2018: https://www.bund.net/service/publikationen/detail/publication/bund-gewaesserreport-2018/
Guter Tag auch für das Trinkwasser: Kommentar: Sieg der Vernunft – EuGH bestätigt Verbot von bienenschädlichen Nervengiften im Freiland
 (6. Mai 2021) Anlässlich der Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) zur Abweisung einer Bayer-Klage gegen das Verbot bienenschädlicher Nervengifte kommentiert der BUND-Vorsitzende Olaf Bandt:
(6. Mai 2021) Anlässlich der Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) zur Abweisung einer Bayer-Klage gegen das Verbot bienenschädlicher Nervengifte kommentiert der BUND-Vorsitzende Olaf Bandt:
„Die Entscheidung des Europäischen Gerichthofs ist ein Sieg der Vernunft und ein wichtiges Signal für den Schutz von Insekten in Europa. Neonikotinoide gefährden Bienen und andere Insekten enorm und sind mitverantwortlich für das dramatische Insektensterben. Der Schutz der Artenvielfalt ist absolut unvereinbar mit der Aufhebung des Verbots von hochwirksamen Nervengiften für Bienen und Wildbienen. Pestizide mit solch fataler Wirkung auf das Ökosystem dürfen nie wieder in die Umwelt gelangen.
Profitgier hat Bayer blind gegen wissenschaftliche Erkenntnisse gemacht: Zahlreiche wissenschaftliche Studien haben die Gefahr der drei umstrittenen Neonikotinoide für Bienen und Wildbienen umfassend bewiesen. Neonikotinoide sind langlebig und reichern sich im Boden an. Aufgrund ihrer Wasserlöslichkeit können sie weit transportiert werden und gelangen auch in Gegenden fernab ihrer Einsatzgebiete, wo sie dann noch jahrelang Schäden verursachen. Trotz ihrer erheblichen Einschränkung 2013 und dem Freilandverbot 2018 sind die Wirkstoffe heute immer noch in Gewässern nachweisbar.
Um das Insektensterben zu stoppen, brauchen wir neben dem Verbot solcher besonders gefährlichen Pestizide zusätzlich auch eine deutliche Reduktion des Pestizideinsatzes.“
Zum Beitrag
Martin Häusling (MdEP): EuGH zu Einspruch von Bayer: Neonikotinoide sind mit vollem Recht verboten!
Das deutliche Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) zum Verbot von Neonikotinoiden muss zugleich als ein Appell verstanden werden, den Missbrauch dieser Insektizide durch Notfallzulassungen für immer zu beenden, meint Martin Häusling, agrarpolitischer Sprecher der Grünen im Europäischen Parlament und Mitglied im Umweltausschuss:

„Bayers Aufbäumen war vergebens. Der Europäische Gerichtshof hat bestätigt, dass das Handeln der Europäischen Kommission, die hochumstrittenen, aus Sicht von Gesundheits- und Artenschutz gefährlichen Gifte aus der Gruppe der Neonikotinoide aus dem Verkehr zu ziehen, rechtens war. Der Bayer-Konzern muss damit eine Niederlage einstecken.
Das Urteil der Richter muss auch als Appell an die EU-Mitgliedsländer, an die Bauernverbände und auch an die Industrie verstanden werden. Finger weg von giftigen Neonikotinoiden! Wie nun noch einmal höchstrichterlich bestätigt, sind sie aus gutem Grund verboten. Dieses Verbot über Notfallgenehmigungen zu umgehen, ist ein ökologisches Verbrechen, auch wenn die aktuelle Gesetzeslage dieses Schlupfloch noch offen lässt.
Es muss endlich Schluss sein mit der Praxis, immer wieder über Notfallzulassungen geltendes Recht und damit den dahinter stehenden Gedanken des Schutzes unserer Gesundheit und unserer Natur auszuhebeln. Statt sich auf dieses Instrument zu verlassen, müssen sich Behörden, Landwirte und Industrie endlich auf Formen der Landwirtschaft besinnen, die solche Extrem-Gifte überflüssig machen. Dass dies gelingen kann, machen Tausende von Bio-Bauern jeden Tag vor.
Oft genügt es, sich auf die gute fachliche Praxis, auf mehr Fruchtfolgen oder mehr mechanische Methoden zu besinnen, um den Einsatz von Giften überflüssig zu machen. Dies gilt nicht nur für Pestizide aus der Klasse der Neonikotinoide, sondern auch für andere Wirkstoffe. Zugleich appelliere ich deshalb an die Kommission, ganz generell bei der Zulassung neuer Wirkstoffe wesentlich stärker als bisher die Folgen für unsere Natur, unsere Lebensmittel und unsere Gesundheit zu beachten.“
Zum Beitrag
Bitte unterstützt die Europäische Bürgerinitiative:
Walchenseekraftwerk: Verbände fordern besseren Schutz der Isar
BR
29. März 2021
Umweltverbände fordern, dass die Flusslandschaft der Oberen Isar bei einer Neukonzessionierung des Walchenseekraftwerks besser geschützt wird. Bisher wird viel Wasser zur Stromerzeugung in den Walchensee abgeleitet. Das bedrohe 200 Rote-Liste-Arten. […]
Walchenseekraftwerk sollte dem Staat gehören
Zu den Forderungen der Verbände gehört auch eine Verstaatlichung. Bayern solle Eigentümer der Anlage werden. […] Bisheriger Betreiber des Walchenseekraftwerks ist der Energiekonzern Uniper.
Zum Beitrag
BBU: Umweltminister Lies bootet Kritiker bei Gesprächen über die Erdgasförderung in Niedersachsen aus

(Bonn, Hannover, 29.03.2021) Mit großer Empörung hat der Bundesverband Bürgerinitiativen Umweltschutz (BBU e.V.) die heutige Pressekonferenz von Umweltminister Olaf Lies und den 10-Punkte-Plan zur zukünftigen Politik der Erdöl- und Erdgasförderung in Niedersachsen zur Kenntnis genommen. Statt den 2018 begonnenen Stakeholderdialog Erdöl- und Erdgasförderung weiterzuführen, hat der Minister offensichtlich eine neue Runde zusammengestellt, die hinter verschlossenen Türen getagt hat. Der BBU, der sich intensiv, kritisch und mit großer Sachkompetenz in den Stakeholderdialog eingebracht hatte, war weder zu der neuen Runde noch zur heutigen Pressekonferenz eingeladen.
Oliver Kalusch vom Geschäftsführenden Vorstand des BBU erklärt hierzu:
„Man merkt die Absicht und man ist verstimmt. Der Minister wollte deutliche Kritiker der Erdöl- und Erdgasförderung aus der Zivilgesellschaft, die sich im Stakeholderdialog intensiv mit technischem Sachverstand eingebracht hatten, vor der Tür halten. So sollten genehme Ergebnisse erreicht werden. Dementsprechend sind die Resultate. So ist der im 10-Punkte-Plan festgehaltene freiwillige Verzicht der Förderindustrie auf Neubohrungen in Wasserschutzgebieten das Papier nicht wert, auf dem er steht. Denn erstens können bestehende Bohrungen weiter betrieben werden. Zweitens kann auch von einem Bohrverbot keine Rede sein. Bei bestehenden Bohrungen kann auch in jede Richtung weiter gebohrt werden. Und drittens ist es problemlos möglich, bei Neubohrungen den Bohransatzpunkt außerhalb des Wasserschutzgebietes zu legen und dann in das Wasserschutzgebiet horizontal hinein zu bohren. Konsequenter Gewässerschutz sieht anders aus.“
Weiter erklärt Oliver Kalusch: „Die Zusammensetzung der neu einzusetzenden Kommission, die technisch verbindliche Regelungen zum bestehenden Regelwerk erarbeiten soll, trifft bei uns auf klare Ablehnung. Zwar hatte der BBU ein Beratungsgremium hierfür mehrfach im Stakeholderdialog gefordert. Allerdings muss dieses auch pluralistisch zusammengesetzt sein und kann nicht ohne die Mitgliedschaft wesentlicher Akteure der Umweltverbände gebildet werden. Vorbild muss dabei die Kommission für Anlagensicherheit beim Bundes-Umweltministerium sein, die alle relevanten Stakeholder einschließlich der Umweltverbände umfasst. Die technische Kommission soll sich hingegen nur aus den Organisationen zusammensetzen, die den 10-Punkte-Plan unterschrieben haben. Wer die Kompetenz der Zivilgesellschaft so außen vor lässt, entwertet die Kommission bereits im Vorfeld und verhindert ein offenes Ergebnis.“
Engagement unterstützen
Zur Finanzierung seines vielfältigen Engagements bittet der BBU um
Spenden aus den Reihen der Bevölkerung. Spendenkonto: BBU, Sparkasse
Bonn, IBAN: DE62370501980019002666, SWIFT-BIC: COLSDE33.
Informationen über den BBU und seine Aktivitäten gibt es im Internet
unter http://www.bbu-online.de <http://www.bbu-online.de> und
telefonisch unter 0228-214032. Die Facebook-Adresse lautet
www.facebook.com/BBU72 <http://www.facebook.com/BBU72>. Postanschrift:
BBU, Prinz-Albert-Str. 55, 53113 Bonn.
Der BBU ist der Dachverband zahlreicher Bürgerinitiativen,
Umweltverbände und Einzelmitglieder. Er wurde 1972 gegründet und hat
seinen Sitz in Bonn. Weitere Umweltgruppen, Aktionsbündnisse und
engagierte Privatpersonen sind aufgerufen, dem BBU beizutreten um die
themenübergreifende Vernetzung der Umweltschutzbewegung zu verstärken.
Der BBU engagiert sich u. a. für menschen- und umweltfreundliche
Verkehrskonzepte, für den sofortigen und weltweiten Atomausstieg, gegen
die gefährliche CO2-Endlagerung, gegen Fracking und für
umweltfreundliche Energiequellen.
Insekten- und Gewässerschutz prioritär, ambitioniert und gemeinsam angehen
Gemeinsame Pressemitteilung von Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND), Deutsche Umwelthilfe (DUH), Naturschutzbund Deutschland (NABU), Grüne Liga und WWF Deutschland und ihres Dachverbandes Deutscher Naturschutzring (DNR)
Umweltministerkonferenz
Insekten- und Gewässerschutz prioritär, ambitioniert und gemeinsam angehen
6. November 2018. Anlässlich der morgen beginnenden 91. Umweltministerkonferenz von Bund und Ländern appellieren die Naturschutzverbände BUND, DUH, NABU, Grüne Liga, WWF und ihr Dachverband Deutscher Naturschutzring in einem gemeinsamen Schreiben an die Umweltminister und -senatoren, die enormen Herausforderungen zum Insekten- und Gewässerschutz gemeinsam anzugehen und auf eine stärkere Kohärenz und Integration der Ziele des Insekten- und Gewässerschutzes in über die Umweltpolitik hinausreichende Politikbereiche und Gesetzgebungsvorhaben hinzuwirken.
„Die Verschmutzung unseres Trinkwassers und das Massensterben unserer Insekten haben die gleiche Ursache: Eine verfehlte Landwirtschaftspolitik, die den massenhaften Eintrag von Pestiziden und Düngern fördert. Was wir brauchen, ist ein ressortübergreifendes Sofortprogramm für eine vielfältige und gesunde Natur! Wer die Gewässer rettet, rettet auch Insekten“, betont Kai Niebert, Präsident des Deutschen Naturschutzrings.
„Die Problemlage ist klar, jetzt geht es um Lösungen. Wenn wir im Insekten- wie im Gewässerschutz etwas erreichen wollen, dann wird dies nur über eine naturverträglichere EU-Agrarpolitik funktionieren. Die Umwelt- und Agrarminister der Länder müssen gemeinsam von Bundeslandwirtschaftsministerin Klöckner fordern, sich bei den derzeitigen GAP-Verhandlungen in Brüssel für ambitionierten Naturschutz und ausreichende Finanzmittel einzusetzen“ stellt NABU-Bundesgeschäftsführer Leif Miller klar.
„Gewässerrandstreifen sind für den Schutz der Wasserressourcen, aber auch als Rückzugsraum für Insekten von elementarer Bedeutung. Deshalb plädieren wir für bundesweit einheitliche Gewässerrandstreifen von mindestens zehn Metern Breite, innerhalb derer die Ausbringung von Düngern und Pestiziden verboten ist,“ führt Hubert Weiger, Vorsitzender des BUND, aus. Er fordert weiter: „Um alle Gewässer bis 2027 wieder in einen guten Zustand zu bringen, muss zudem der Umsetzungsstau bei den notwendigen Maßnahmen jetzt beendet werden. Auf Grundlage der Maßnahmenvorschläge, die die Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA) für die UMK erarbeitet hat, müssen Bundesregierung und Bundesländer einen gemeinsamen Aktionsplan erstellen, der klar darlegt, mit welchen Maßnahmen, Mitteln und Zuständigkeiten die Wasserrahmenrichtlinie umgesetzt werden soll.“
Bundesgeschäftsführer Sascha Müller-Kraenner von der DUH: „Die Bundesregierung muss ihr Nationales Aktionsprogramm zum Schutz von Gewässern vor Verunreinigung durch Nitrat aus landwirtschaftlichen Quellen ausweiten. Das Düngerecht muss deutlich verschärft werden, damit sich betroffene Lebensräume und Arten langfristig erholen können. Ebenso nötig sind eine konsequente Anwendung des Bau- und Immissionschutzrechts durch die Länder sowie finanzielle Anreize, um Stoffeinträge zu verringern. Ansonsten drohen eine Verurteilung Deutschlands durch den Europäischen Gerichtshof und Strafzahlungen an die EU. Denn die Spatzen pfeifen es schon von den Dächern: Der EU-Kommission genügen die von der Bundesregierung bisher ergriffenen Maßnahmen zur Reduzierung der Nitratbelastung nicht.“
„Pestizide zu reduzieren hilft Insekten und Gewässern gleichermaßen. Seit Jahren verschleppt die Bundesrepublik Deutschland, die Vorgaben der EU-Pestizidgesetzgebung umzusetzen. Der Nationale Aktionsplan Pflanzenschutz (NAP) muss endlich überarbeitet werden, um Wirkung zu entfalten. Auch werden viele der in der Landwirtschaft eingesetzten Pestizid-Wirkstoffe von der Gewässerüberwachung gar nicht oder nur unzureichend erfasst. Es ist höchste Zeit, im Rahmen der geplanten Ackerbaustrategie endlich eine Verpflichtung zu einer konsequent ressourcenschonenden landwirtschaftlichen Bewirtschaftungspraxis auf den Weg zu bringen“, kommentiert Michael Bender, Leiter der GRÜNE LIGA Bundeskontaktstelle Wasser.
Nach Hitzesommer: Gewässerschutz braucht politische Priorität
Gemeinsame Pressemitteilung von BUND, Grüne Liga, NABU, WWF und dem Umweltdachverband Deutscher Naturschutzring anlässlich des WRRL-Verbändeforum am 31.08./01.09.2018 im Bundesamt für Naturschutz (Bonn)

Nach Hitzesommer: Gewässerschutz braucht politische Priorität
Umweltverbände fordern konsequente Umsetzung der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) und Integration ihrer Ziele in alle Politikbereiche und Reformvorhaben
Berlin/Bonn, 31.08.2018 – Die Lehre dieses Sommers ist eindeutig: Die anhaltende Trockenheit in vielen Regionen Deutschlands hat unseren Ökosystemen schwer zugesetzt und enormen ökologischen und ökonomischen Schaden angerichtet. Mit Blick auf den Klimawandel wird der Schutz der überlebenswichtigen Ressource Wasser zu einer der dringendsten Herausforderungen, die auf Deutschland und Europa in den kommenden Jahren zukommen. Zu dieser Debatte hat das Verbändebündnis von BUND, Grüne Liga, NABU, WWF und der Dachverband Deutscher Naturschutzring heute Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft nach Bonn eingeladen.
Die vor achtzehn Jahren von allen EU-Mitgliedstaaten beschlossenen Ziele zum Schutz von Grundwasser, Flüssen, Seen und Küstengewässern werden europaweit verfehlt. Erreichen EU-weit zumindest vierzig Prozent das Ziel eines guten ökologischen Zustandes, sind es in Deutschland gerade einmal acht Prozent. Diese massiven Umsetzungsdefizite können die deutsche, aber auch die europäische Politik nicht zufriedenstellen.
Das lässt allerdings nicht den Schluss zu, dass die Ziele zu hoch gesteckt sind. Sie wurden nur nicht ambitioniert genug verfolgt und umgesetzt. Eine Verschiebung des Zieles, intakte Gewässer und sauberes Grundwasser flächendeckend wiederherzustellen wäre ein politisches Armutszeugnis.
Die richtige politische Konsequenz kann nur sein, für die Erreichung der Ziele der Wasserrahmenrichtlinie alle Politikbereiche in die Pflicht zu nehmen. Es muss endlich Schluss damit sein, mit den begrenzten Maßnahmen und Mitteln der Umweltpolitik ausgleichen zu wollen, was durch eine verfehlte Integration in andere Politikbereiche zunichtegemacht wird.
Am Beispiel der Agrarpolitik heißt das: EU-Kommission, EU-Parlament und Europas Mitgliedsstaaten müssen in der aktuellen Reformrunde dafür Sorge tragen, dass die Nutzung unserer natürlichen Ressourcen nur unter Bedingung einer umfassenden Schutzverpflichtung erlaubt ist. Dazu gehört die Garantie, dass von der Gesellschaft gewährte Subventionen diese Ziele nicht konterkarieren dürfen.
Die Bundesregierung ist gut beraten, als Vorreiterin einer solchen Politik in Erscheinung zu treten, wenn sie, nach der Nitratrichtlinie, nicht sehenden Auges eine nächste Verurteilung wegen der Nichteinhaltung der EU-Wasserrahmenrichtlinie riskieren will.
Wie der Schutz unserer Wasserressourcen gelingen kann und welche Positionen die Verbände bei der Überprüfung der Wasserrahmenrichtlinie vertreten, wird am 31. August und 01. September beim WRRL-Verbändeforum in Bonn diskutiert. Die Veranstaltung ist kostenfrei, kurzfristige Teilnahme ist möglich.
Weitere Informationen:
Programm WRRL-Verbändeforum hier
Pressekontakt:
Nina Slattery, DNR-Referentin Presse und Kommunikation, Tel.: 030/678177578, Nina.Slattery@dnr.de
Hitzewelle. Allianz der öffentlichen Wasserwirtschaft mahnt: Sorgsamer Umgang mit Wasserressourcen nötig
 Pressemitteilung der Allianz der öffentlichen Wasserwirtschaft e.V. vom 8. August 2018
Pressemitteilung der Allianz der öffentlichen Wasserwirtschaft e.V. vom 8. August 2018
Plötzlich wird wieder einmal überdeutlich wie wichtig der sorgsame Umgang mit Wasser ist betont die Allianz der öffentlichen Wasserwirtschaft (AöW). „Die Trinkwasserversorgung ist sicher, weil die Wasserwirtschaft seit Jahren vorsorgend handelt und den Schutz der Wasserressourcen durchgesetzt hat, beim Grundwasser und bei den Trinkwassertalsperren“, betonte der Präsident der AöW, Prof. Dr.-Ing. Lothar Scheuer. Wenn künftig mit weiteren heißen Sommern gerechnet werden muss, braucht die Wasserwirtschaft dafür noch mehr Rückhalt.
Berlin. Bei der anhaltenden Hitze brauchen die Menschen, Flora und Fauna und fast alle Wirtschaftszweige mehr Wasser zur Aufrechterhaltung des Kreislaufs, zur Kühlung und Klimatisierung. Wasser, das durch ausbleibende Regenfälle fehlt oder bei Unwetter an einzelnen Stellen im Übermaß schlagartig anfällt. Die AöW weist darauf hin, dass ein vorsorgender Gewässerschutz, insbesondere die Vermeidung von Verschmutzungen der Gewässer, verstärkt angegangen werden muss. Ein Kredo, das die AöW und die öffentlichen Wasserversorger, Abwasserbetriebe und Wasser- und Bodenverbände, die Mitglied der AöW sind, schon lange vertreten. „Wer unsere Umwelt und unsere wichtigste Ressource für das Leben der Menschen schützen will, muss ganzheitlich denken und handeln“, verdeutlichte Scheuer heute in Berlin.

Foto: AöW
Die AöW sieht keinen Anlass zur Panikmache, will aber auch angesichts der Besorgnis der Bürgerinnen und Bürger nicht abwiegeln. Die aktuelle Betroffenheit der Landwirte wegen der Ernteausfälle versteht die AöW, sie mahnt jedoch an, dass bei Lösungsvorschlägen für die Zukunft der Vorsorgegrundsatz beachtet werden muss. Dabei sind die wasserwirtschaftlichen Rahmenbedingungen in unserem Land in weiten Teilen günstig.
Das heißt für die AöW: Die natürlichen Wasservorkommen müssen sowohl mengenmäßig als auch in der Qualität geschützt werden. Darauf müssen auch alle anderen Wirtschaftszweige Rücksicht nehmen und die Bewahrung des Wasserschatzes darf nicht nur der Wasserwirtschaft aufgetragen oder sogar aufgebürdet werden. Die AöW fordert daher alle Bürgerinnen und Bürger und die Politik dazu auf, sich für diese Ziele einzusetzen.
Pressemitteilung als pdf
Kontakt:
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
E-Mail: presse@aoew.de. www.aoew.de
Tel.: 0 30 / 39 74 36 06
Die Allianz der öffentlichen Wasserwirtschaft e.V. (AöW)
Die AöW ist die Interessenvertretung der öffentlichen Wasserwirtschaft in Deutschland. Zweck des Vereins ist die Förderung der öffentlichen Wasserwirtschaft durch die Bündelung der Interessen und Kompetenzen der kommunalen und verbandlichen Wasserwirtschaft. weiterlesen
NABU fordert konsequenteren Schutz der Gewässer in Deutschland
NABU-PRESSEMITTEILUNG | NR 79/15 | 22. JUNI 2015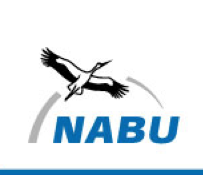
Umwelt /Flüsse/EU
NABU fordert konsequenteren Schutz der Gewässer in Deutschland
Tschimpke: Jetzt die Weichen für lebendige Gewässer und sauberes Grundwasser stellen
Berlin – Am heutigen Montag endet die Öffentlichkeitsbeteiligung zu den Bewirtschaftungsplänen und Maßnahmenprogrammen der Wasserrahmenrichtlinie. Mit den Programmen wird der Grundstein für die Gewässerbewirtschaftung für die nächsten sechs Jahre gelegt. Das ursprüngliche Ziel eines guten Gewässer- und Grundwasserzustands bis 2015 wurde weit verfehlt. NABU-Präsident Olaf Tschimpke appellierte an Politik und Verwaltung, eine ambitioniertere Bewirtschaftungsplanung vorzunehmen: „In vielen Flussgebieten erreichen nicht mal zehn Prozent der Gewässer die EU-Umweltziele. Die Weichen für lebendige Gewässer und sauberes Grundwasser müssen jetzt dringend gestellt werden.“
Die EU-Kommission stellte bereits in einer Analyse fest, dass der bisherige Ansatz, sich ausgehend von einem ungenügenden Status Quo lediglich in die richtige Richtung zu bewegen, eindeutig nicht ausreicht, um die Umweltziele zu erreichen. So ist es nicht überraschend, dass das schon für das Jahr 2015 anvisierte Ziel eines guten Zustandes der Gewässer und des Grundwassers in der Bundesrepublik nahezu flächendeckend verfehlt wird. Aus NABU-Sicht müssen die vorgelegten Maßnahmenprogramme zügig nachbearbeitet werden, um grundlegende Verbesserungen beim Zustand unserer Gewässer zu erreichen. Der NABU behält sich vor, eine Beschwerde bei der Europäischen Kommission einzureichen, wenn die Programme nicht deutlich verbessert würden. Dies könnte zu einem Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland führen. Die Probleme seien bekannt, nun gehe es darum, diese auch wirklich anzugehen.
„Einträge von Nährstoffen und Pflanzenschutzmitteln aus der Landwirtschaft, Altlasten und Gewässerverbau erfordern konsequentes Handeln und eine Verbindlichkeit in der Maßnahmenumsetzung. Beispielsweise müssen die zuständigen Behörden personell in die Lage versetzt werden, bereits bestehende Auflagen zum Gewässerschutz zu kontrollieren. Außerdem dürfen die vielfach guten Planungen nicht in den Schubladen verstauben, sondern müssen auch in die Tat umgesetzt werden. Auch hier fehlt es an finanziellen Mitteln und ausreichend Personal“, sagte NABU-Gewässerexpertin Julia Mußbach.
Generell ist es notwendig, die Ziele der Wasserrahmenrichtlinie stärker als bisher in andere Politikfelder zu integrieren. So müssten hohe Standards zum Gewässerschutz bei der anstehenden Novelle der Düngeverordnung verankert sowie verstärkt Synergien mit der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (FFH) und dem naturnahen Hochwasserschutz, beispielsweise bei der Renaturierung von Auen, genutzt werden.
Mit der Wasserrahmenrichtlinie 2000/60/EG haben sich die Mitgliedstaaten der EU und das Europäische Parlament im Herbst 2000 dazu verpflichtet, alle Binnengewässer wie Flüsse und Seen, aber auch Übergangs- und Küstengewässer bis 2015 in einen „guten ökologischen und chemischen Zustand“ zu versetzen. Gut 80 Prozent der deutschen Flüsse und Bäche verfehlten dieses Ziel laut einer Studie des Umweltbundesamtes. Der Gradmesser für intakte Gewässer sind die im Wasser lebenden Fische und wirbellosen Kleinlebewesen, Algen und Wasserpflanzen.
Stellungnahme des NABU zum Download:
www.NABU.de/natur-und-landschaft/fluesse/wrrl.html
Zwischenbilanz von Bundesumweltministerium und Umweltbundesamt zur Umsetzung der Maßnahmenprogramme: www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/378/publikationen/wasserrahmenrichtlinie_2012.pdf
Für Rückfragen:
Julia Mußbach, NABU-Gewässerreferentin, Telefon +49 (0)30-284984-1629, E-Mail: Julia.Mussbach@NABU.de
————————————————————————————————————-
NABU-Pressestelle
Kathrin Klinkusch | Iris Barthel | Britta Hennigs | Nicole Flöper
Tel. +49 (0)30.28 49 84-1510 | -1952 | -1722 | -1958
Fax: +49 (0)30.28 49 84-2000 | E-Mail: presse@NABU.de
Unterirdische Nutzungen und Gewässerschutz
Aktuelle ordnungspolitische und technische Fragestellungen rund ums Trinkwasser sind Themen der Wasserfachlichen Aussprachetagung (wat), vom 29. September bis 1. Oktober 2014 in Karlsruhe. Das Leitthema lautet: „Sicherheit und Qualität in der Versorgung zukunftsfähig gestalten“.
Kommentar Wassertisch: Im Zusammenhang mit den Gefahren, die durch Fracking und CCS-Verfahren entstehen, ist uns die Vorweg-Zusammenfassung eines Vortrags des Diplom Geologen Martin Böddeker aufgefallen, die auf der Webseite der Tagung unter dem Titel „Unterirdische Nutzungen und Gewässerschutz – Gefährdungen, Verbreitung, Handlungsmöglichkeiten“ (PDF) zur Verfügung steht. Den Vortrag wird Herr Böddeker am 29. Sept. 2014 auf der Tagung halten.
Hier heißt es unter anderem: „Fraglich ist, ob die nach hydrogeologischen Kriterien ausgewiesenen Wasserschutzgebiete die Wirkreichweiten und Risiken der unterirdischen Nutzungen ausreichend berücksichtigen können.“ Und weiter: „Bislang fehlen allerdings anerkannte Kriterien und Regelungen, wie ein Umgebungsschutz angesichts unterschiedlicher Wirkreichweiten und der geologischen Beschaffenheit des Untergrundes räumlich abgegrenzt werden kann.“
Zur Zusammenfassung des Vortrags kommen Sie hier![]()
UN-Gewässer-Konvention tritt in Kraft
Bundesumweltministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit
15.08.2014
UN-Gewässer-Konvention tritt in Kraft. Hendricks: Großer Schritt für internationale Zusammenarbeit im Gewässerschutz
Das Bundesumweltministerium begrüßt das Inkrafttreten der UN-Gewässer-Konvention zur verbesserten Zusammenarbeit von Flussanrainern. „Damit gilt erstmals weltweit ein rechtlicher Rahmen für die Zusammenarbeit an internationalen Gewässern. Dies kann auch zur Vermeidung und friedlichen Lösung zwischenstaatlicher Konflikte um die knappe Ressource Süßwasser beitragen“, sagte Bundesumweltministerin Barbara Hendricks. Das Übereinkommen tritt am kommenden Sonntag (17. August) in Kraft.
„Angesichts der begrenzten Süßwasserressourcen unserer Erde ist eine grenzüberschreitende Zusammenarbeit bei ihrer Nutzung dringend geboten“, sagte Hendricks. Das neue Abkommen sei „ein großer Schritt vorwärts“ in diese Richtung. „Wir haben jetzt global verbindliche Regeln für die Zusammenarbeit an internationalen Wasserläufen. Jetzt kommt es darauf an, das Übereinkommen mit Leben zu füllen und dafür zu werben, dass in den nächsten Jahren weitere Staaten beitreten.“
Mit der sogenannten „UN Watercourses Convention“ (UN-Gewässer-Konvention) werden bisher ungeschriebene völkerrechtliche Grundsätze über das gutnachbarliche Verhalten zwischen den Anrainerstaaten grenzüberschreitender Binnengewässer verankert und fortentwickelt. Hierzu zählt die Verpflichtung zu einer ausgewogenen und angemessenen Nutzung grenzüberschreitender Wasserläufe und zur Verhinderung beträchtlicher Schäden bei anderen Staaten im Einzugsgebiet eines gemeinsamen Wasserlaufs.
Die Generalversammlung der Vereinten Nationen hatte die Konvention bereits 1997 mit breiter Mehrheit angenommen. Deutschland unterzeichnete das Übereinkommen 1998 und ratifizierte es 2006. Mit der Hinterlegung der 35. Ratifikationsurkunde durch Vietnam sind die Voraussetzungen für sein Inkrafttreten erfüllt.
Deutschland kooperiert bereits seit vielen Jahren mit den Nachbarstaaten im Einzugsgebiet seiner großen Flüsse. Die Flussgebietsübereinkommen zum Schutz von Rhein, Donau, Elbe und Oder gehen allerdings weit über die UN-Gewässerkonvention hinaus. Im Rahmen des neuen UN-Übereinkommens möchte die Bundesregierung ihre guten Erfahrungen mit grenzüberschreitendem Gewässerschutz einbringen.
Das bereits 1992 unterzeichnete Übereinkommen der UN ECE (United Nations Economic Commission for Europe = Wirtschaftskommission der Vereinten Nationen für Europa) zum Schutz und zur Nutzung grenzüberschreitender Wasserläufe und internationaler Seen wird sich in Kürze ebenfalls für eine weltweite Anwendung öffnen. Die Bundesregierung sieht die beiden Übereinkommen als sich sinnvoll ergänzende Instrumente und wird darauf hinwirken, die potentiellen Synergien zwischen den beiden Übereinkommen zu nutzen.
Zur Pressemitteilung
Berlin sieht der Eutrophierung der Nord- und Ostsee tatenlos zu
VSR-Gewässerschutz e.V.
14.07.2014
Pressemitteilung
Zur Pressemitteilung (pdf).
Zur Seite mit den Pressemitteilungen des VSR.
Website VSR-Gewässerschutz e.V.
EEG-Novelle muss Trinkwassersicherheit und Gewässerschutz gewährleisten
Die aktuelle Pressemitteilung der GRÜNEN LIGA e.V.

EEG-Novelle muss Trinkwassersicherheit und Gewässerschutz gewährleisten
Berlin, 2. Juni 2014: Bei der heutigen Expertenanhörung im Wirtschaftsausschuss kommen die wasserwirtschaftlichen Belange der Novelle des Erneuerbare Energiengesetzes zu kurz.
Der Gesetzentwurf der Bundesregierung vom 5. Mai 2014 vermerkt im Einleitungssatz, die Energiewende sei „ein richtiger und notwendiger Schritt auf dem Weg in eine Industriegesellschaft, die dem Gedanken der Nachhaltigkeit, der Bewahrung der Schöpfung und der Verantwortung gegenüber nachfolgenden Generationen verpflichtet ist“. Bei kaum einem Schutzgut beweist sich dieser Anspruch mehr als bei unseren Trinkwasserressourcen und Gewässern. Die bisherigen Fehlsteuerungen durch das EEG und ihre gravierenden negativen Auswirkungen müssen dringend korrigiert werden.
Die GRÜNE LIGA sieht hinsichtlich des Gewässerschutzes folgende Kernpunkte:
1. Kein weiterer Ausbau der Stromerzeugung aus Biomasse, insbesondere nicht auf der Basis von Mais. Die im Gesetzentwurf vorgesehene Deckelung des Zubaus für neue Biogasanlagen auf 100MW pro Jahr (§27) darf auf keinen Fall aufgeweicht werden. Geboten ist eher eine Verschärfung.
2. Konzentration der Förderung bei Neuanlagen auf Abfall- und Reststoffe. Die Streichung der auf Einsatzstoffe bezogenen Vergütung (§27) ist daher zu begrüßen.
3. Dringend geboten ist zusätzlich ein Umbau der Förderstruktur für Bestandsanlagen mit dem Ziel, insbesondere den Anbau und Einsatz von Mais deutlich zurückzudrängen.
4. Die Festlegung von Nachhaltigkeitskriterien für Anbau für Biomasse durch eine entsprechende Verordnung (§87) ist grundsätzlich zu begrüßen. Diese Kriterien müssen aber insbesondere auch Anforderungen des Gewässerschutzes aufgreifen.
5. Die Förderung der aus Klimaschutzsicht irrelevanten mittleren und kleinen Wasserkraft (bis 5 MW) verbindet ökonomische Ineffizienz mit unverhältnismäßigen ökologischen Schäden, verletzt das Verursacherprinzip und sollte komplett eingestellt werden.
Michael Bender, Leiter der Bundeskontaktstelle Wasser betont: „Die bisherige Biomasseförderung durch das EEG ist, zusammen mit den Agrarsubventionen, ein maßgeblicher Grund dafür, dass die Nährstoffreduktionsziele der Wasserrahmenrichtlinie für die Oberflächengewässer und Küstengewässer, aber auch für das Grundwasser in weiten Teilen Deutschlands verfehlt werden.“ Insbesondere die intensive Ausweitung des Maisanbaus hat dramatische Auswirkungen auf unsere Trinkwasservorkommen und für die ökologische Qualität unserer Gewässer. Diese Einschätzung wird deutschlandweit von Gewässerkundlern, Wasserversorgern und Wissenschaftlern geteilt, wie die Zusammenstellung (pdf) zeigt.
Die Wasserkraftnutzung geht regelmäßig mit der direkten Schädigung des Fischbestandes einher, dem zahlreiche FFH-Arten angehören. Insbesondere bei der Abwanderung des inzwischen akut vom Aussterben bedrohten Aals treten beim Turbinendurchgang Verlustraten von bis zu 100 % auf.
Die Errichtung von geeigneten, gut auffindbaren Fischaufstiegsanlagen und Fischabstiegen mit ausreichenden Restwassermengen und der Ausgleich der sonstigen gewässerökologischen Schäden muss Voraussetzung für die Förderung nach dem EEG sein, nicht allein die Erhöhung der Leistung. Der vorgesehene teilweise Verzicht auf wasserrechtliche Nachweise macht das EEG zu einem Instrument zur Verhinderung der Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie in Deutschland.
Ansprechpartner:
Michael Bender / Tobias Schäfer
GRÜNE LIGA e.V.
Bundeskontaktstelle Wasser / Water Policy Office
Haus der Demokratie und Menschenrechte
Greifswalder Straße 4
10405 Berlin
Tel.: +49 30 / 40 39 35 30 Fax: 204 44 68
e-mail: wasser@grueneliga.de
internet: http://www.wrrl-info.de


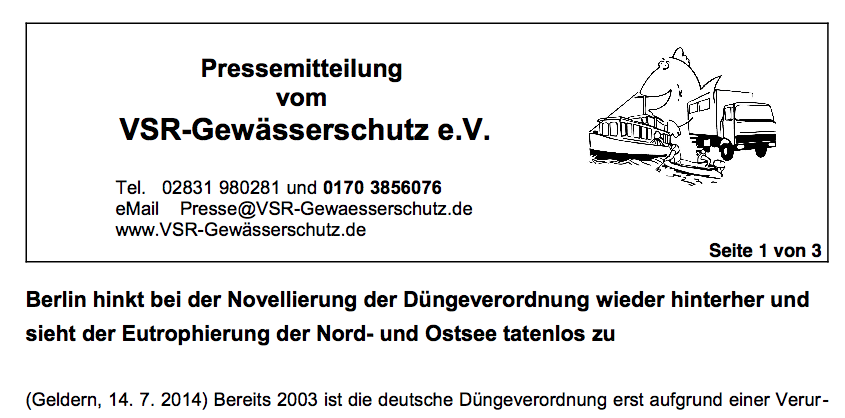


 Pressemitteilungen
Pressemitteilungen